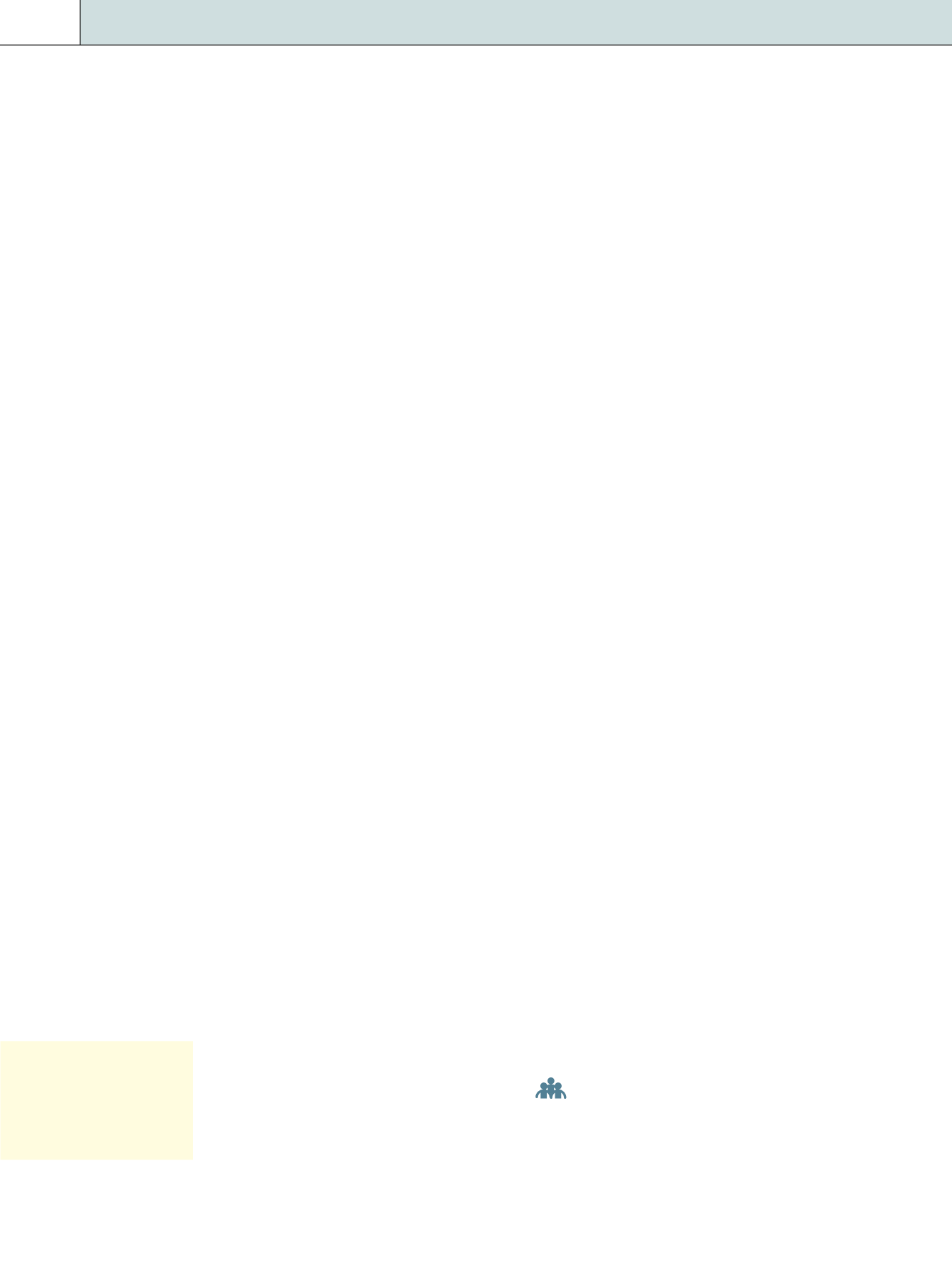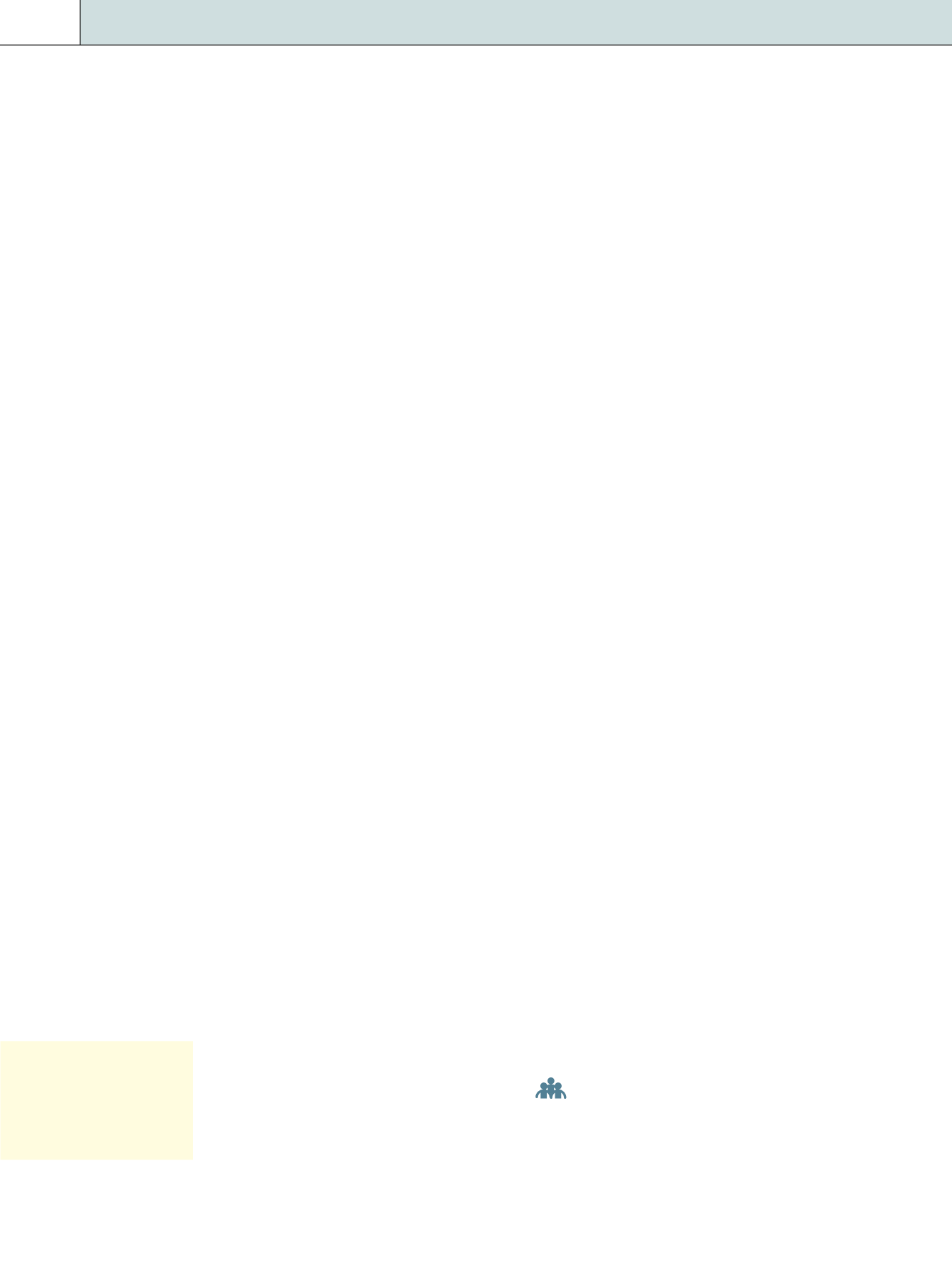
Politische Willensbildung
Die Entstehung von Parteien
Wer zum ersten Mal zur Wahl geht, der wundert sich vielleicht, wie viele Parteien
sich um die Gunst des Wählers und sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel bemühen.
Wie kann es sein, dass in Deutschland so viele Parteien existieren? Parteien gehören
nicht gerade zu den beliebtesten Großorganisationen im Land und doch werden
immer wieder neue gegründet – warum?
Die politische Soziologie hat verschiedene Antworten auf diese Frage.
Milieutheo
retiker
sind der Auffassung, Parteien repräsentieren verschiedene soziale Milieus
der Gesellschaft.
Konflikttheoretiker
sehen die ökonomischen und kulturellen
Konflikte in einer Gesellschaft als Ursache für das Entstehen von Parteien. Einen
solchen Zusammenhang zwischen dem Spannungspotential einer Gesellschaft und
der Entstehung von Parteien entdeckten Ende der 1960er-Jahre die Wissenschaftler
Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan und entwickelten daraus eine
Theorie der
Konfliktlinien
(
„cleavages“
).
Nicht jeder gesellschaftliche Konflikt führe zwangsläufig zu einer Parteigründung,
fanden die Wissenschaftler heraus, doch wenn er im Zusammenhang mit tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Veränderungen aufbreche, könne er durchaus zum Anlass
einer Parteigründung werden.
So wurden seit dem 19. Jahrhundert in den europäischen Gesellschaften ökonomi-
sche und kulturelle Konfliktlinien sichtbar, die das Potential von Spaltungsstrukturen
hatten – wie die Gegensätze zwischen Arbeit und Kapital oder Staat und Kirche. Im
Spannungsfeld zwischen Arbeit und Kapital entstanden Arbeiterparteien, aus dem
Spannungsfeld zwischen Staat und Kirche ging in den Kulturkämpfen in Preußen /
Deutschland die deutsche Zentrumspartei als Partei des politischen Katholizismus
hervor. In einem Parteiensystem – so die Cleavage-Theoretiker – spiegeln sich die
Konfliktlinien einer demokratischen Gesellschaft. Sie spiegeln sich dort und sie wer-
den dort institutionalisiert, d. h. sie finden einen Rahmen, in dem sie als Konflik-
te ausgetragen werden können: den organisierten Rahmen einer Partei. Kann die
Cleavage-Theorie auch aktuelle Entwicklungen erklären?
1
|
Geben Sie die Grundzüge der Cleavage-Theorie
in eigenen Worten wieder.
2
|
Wenden Sie die Cleavage-Theorie auf die Entstehung
der Piratenpartei Deutschland an. Untersuchen Sie dafür das
Parteiprogramm der Piraten und ermitteln Sie die Konfliktlinien,
an denen die Partei Stellung bezieht
(
¦
S. 37–39)
.
Nutzen Sie das Lösungselement S. 40.
3
|
Interpretieren und datieren Sie (hypothetisch) die Karikatur.
Nutzen Sie die Texte auf S. 37– 39.
(
¦
METHODENHILFE
)
Interpretation
einer Karikatur
¦
METHODENHILFE
„Karikaturen inter-
pretieren“ S. 78 / 79
36
POLITISCHE WILLENSBILDUNG